In einem Webinar für Führungskräfte schilderte eine Teilnehmerin ihre Frustration: „Mein Team jammert. Ich sage, sie sollen handeln, aber es tut sich nichts.“ Ich musste schmunzeln. Nicht, weil es lustig war, sondern weil ich diese Situation so gut kenne. Und weil ich genau weiß, wie viel Energie in solchen Momenten verloren geht.
Was passiert da eigentlich? Und warum greifen gut gemeinte Appelle oft ins Leere? Diese Fragen beschäftigen mich nicht nur als Coach, sondern auch ganz persönlich. Denn Überzeugungskraft entsteht nicht durch Lautstärke oder Argumente. Sondern durch etwas viel Tieferes.
Lass uns gemeinsam eintauchen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
1. Überzeugung beginnt mit Zuhören – nicht mit Reden
Viele Führungskräfte glauben, Überzeugung entstünde durch starke Worte. Doch wer andere führen will, muss zuerst bereit sein, zuzuhören.
- Zuhören ist kein passives Warten, sondern aktives Verstehenwollen.
- Nur wer hört, was andere wirklich bewegt, kann wirksam antworten.
- Der erste Schritt zur Überzeugung ist die Bereitschaft, die Welt des Gegenübers zu betreten.
Beispiel aus dem Podcast: Statt sofort zu reagieren, lädt eine erfahrene Führungskraft ihre Mitarbeitenden gezielt zum Erzählen ein. Erst daraus entsteht Handlungsspielraum.
2. Reaktanz: Warum Appelle Widerstand erzeugen
Wenn wir sagen: „Du solltest …“ oder „Mach doch endlich …“, dann rufen wir oft ungewollten Widerstand hervor. Psychologisch heißt das: Reaktanz.
- Menschen verteidigen ihre Autonomie, wenn sie sich gedrängt fühlen.
- Appelle aktivieren oft alte Erfahrungen von Bevormundung.
- Wer appelliert, verfehlt oft die Selbstverantwortung des Gegenübers.
Meine Beobachtung: In der Stimme vieler Führungskräfte liegt dann Druck. Dieser Druck überträgt sich – und wirkt gegen die eigene Intention.

3. Proaktiv vs. reaktiv: Wenn Denkstrukturen kollidieren
Die proaktive Führungskraft trifft auf reaktive Mitarbeitende. Was wie Arbeitsverweigerung wirkt, ist oft schlicht ein Unterschied in der inneren Organisation.
- Proaktive denken in Lösungen, reaktive in Bedingungen.
- „Ich kann erst, wenn …“ ist keine Ausrede, sondern ein Muster.
- Wer das erkennt, kann gezielter führen und statt Appellen Fragen stellen.
Tipp: Frag nicht: „Warum hast du … nicht gemacht?“ Frag: „Was wäre ein erster Schritt, der heute möglich wäre?“
4. Die innere Elternrolle loslassen
Viele Führungskräfte agieren unbewusst aus einer Rolle, die sie aus Kindheit oder Schule kennen: die des Erziehers oder der „wissenden“ Instanz.
- Diese Haltung erzeugt ungewollt Hierarchie.
- Mitarbeitende werden klein gemacht, statt empowert.
- Wer aus der Elternrolle aussteigt, schafft echte Begegnung auf Augenhöhe.
Frage an dich: In welchen Situationen fühlst du dich selbst wie ein Vater oder eine Mutter für dein Team?
5. „Management by Champignons“ – und wie man es vermeidet
Ein Bild, das hängen bleibt: Mitarbeitende im Dunkeln halten und nur bei Bedarf „ernten“. Diese ironische Metapher steht für rein zahlengetriebene Führung.
- Wer nur über Zahlen führt, erzeugt Angst statt Engagement.
- Fehlerkultur wird zur Schamkultur.
- Echte Führung braucht Beziehung, nicht nur Kontrolle.
Ausblick: Die jüngeren Generationen verweigern sich dieser Art der Führung zunehmend. Gut so.
6. Guiding statt Controlling
Ein Gegenmodell: Die Führungskraft als Begleiter:in. Als jemand, der Menschen in ihrer Entwicklung sieht und fordert, statt nur zu steuern.
- Fokus auf Potenzial statt nur Performance.
- Gespräche statt Quartalsdruck.
- Vertrauen statt Misstrauen.
Mein Bild dazu: Vom Aussichtsbalkon auf die Interaktionen blicken, nicht nur auf die To-do-Listen.
7. Energie sparen – überzeugen durch Einladung, nicht Kraftakt
Viele Führungskräfte investieren enorme Energie in Überzeugungsversuche, die ins Leere laufen.
- Wer sich selbst unter Druck setzt, sendet diesen weiter.
- Kommunikation wird mühsam, Beziehung leidet.
- Wer einlädt statt überrollt, gewinnt Resonanz.
Erkenntnis: Weniger Anstrengung, mehr Wirkung – durch kluge Fragen, innere Klarheit und echte Präsenz.
Fazit: Die Macht der Stimme beginnt im Zuhören
Überzeugungskraft ist kein Muskelspiel. Sie entsteht dort, wo du bereit bist, dich selbst zu reflektieren, zuzuhören und andere einzuladen.
Wenn du merkst, dass deine Kommunikation nicht mehr die Wirkung zeigt, die du dir wünschst – dann lohnt sich ein neuer Blick. Von oben. Vom Balkon aus.
🎯 Du willst genauer hinschauen, wo deine Überzeugungskraft heute an ihre Grenzen stoßt?
Dann komm auf einen Espresso mit mir – ich höre zu.
Und du?
In welchen Situationen setzt du auf Lautstärke, wo Zuhören klüger wäre?
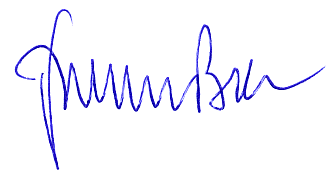 Dein
Dein
Arno Fischbacher
P.S.: Wenn Du diesen Beitrag interessant findest, teile ihn gern! Hast Du eine Frage oder willst etwas mit mir diskutieren? Schreib einen Kommentar!
Der Autor:
Als erfahrene Führungskraft und Coach verbindet Arno Fischbacher fundiertes Wissen mit praxisnahen Lösungen. Mit über 30 Jahren Erfahrung als Schauspieler, Stimmcoach und Redner zeigt er Führungspersönlichkeiten und Teams, wie Du mit souveräner Sprache und kraftvoller Stimme überzeugen kannst. Seine Trainings inspirieren Menschen, ihre Wirkung zu maximieren und Kommunikation neu zu denken. https://arno-fischbacher.com

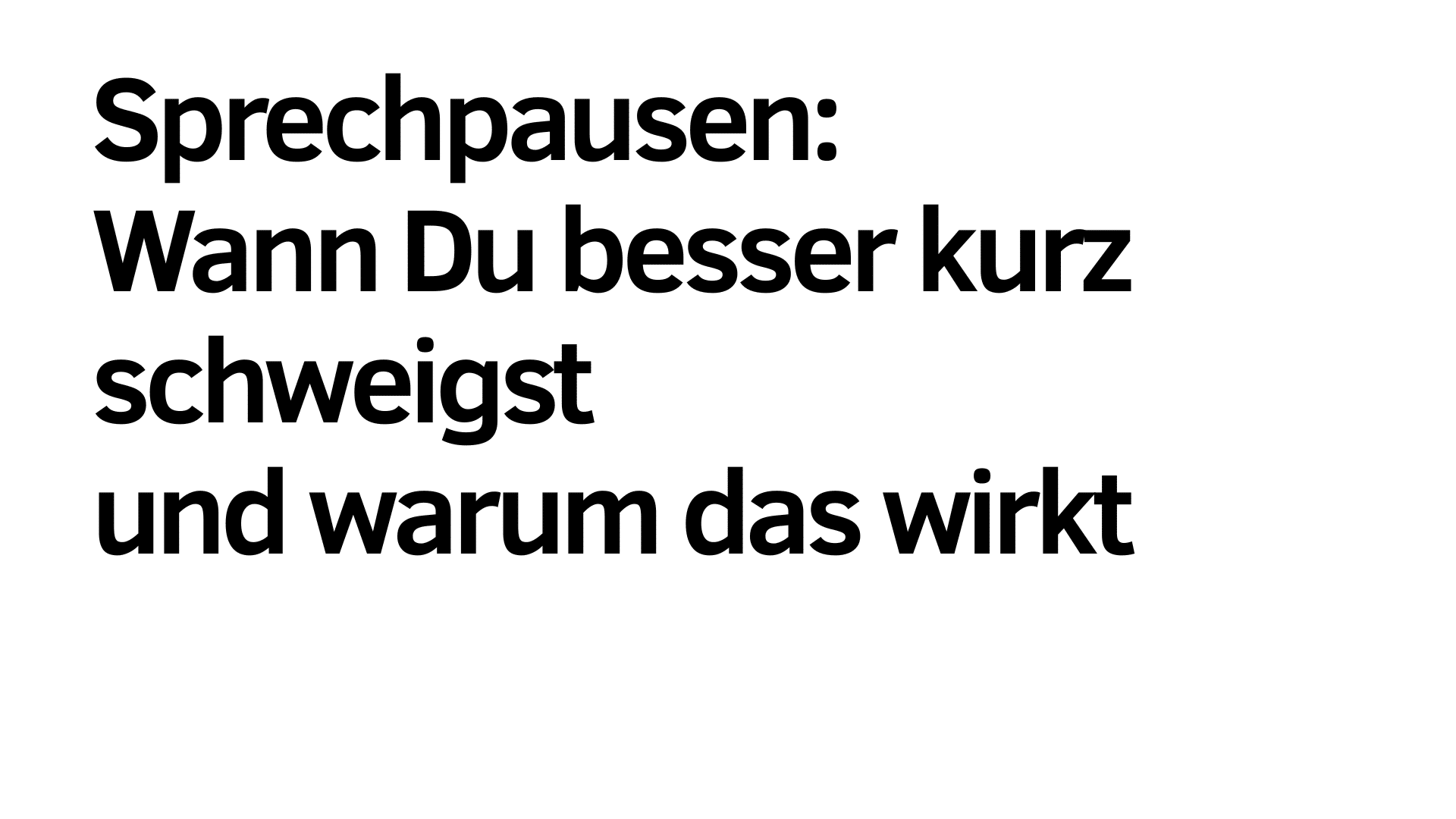
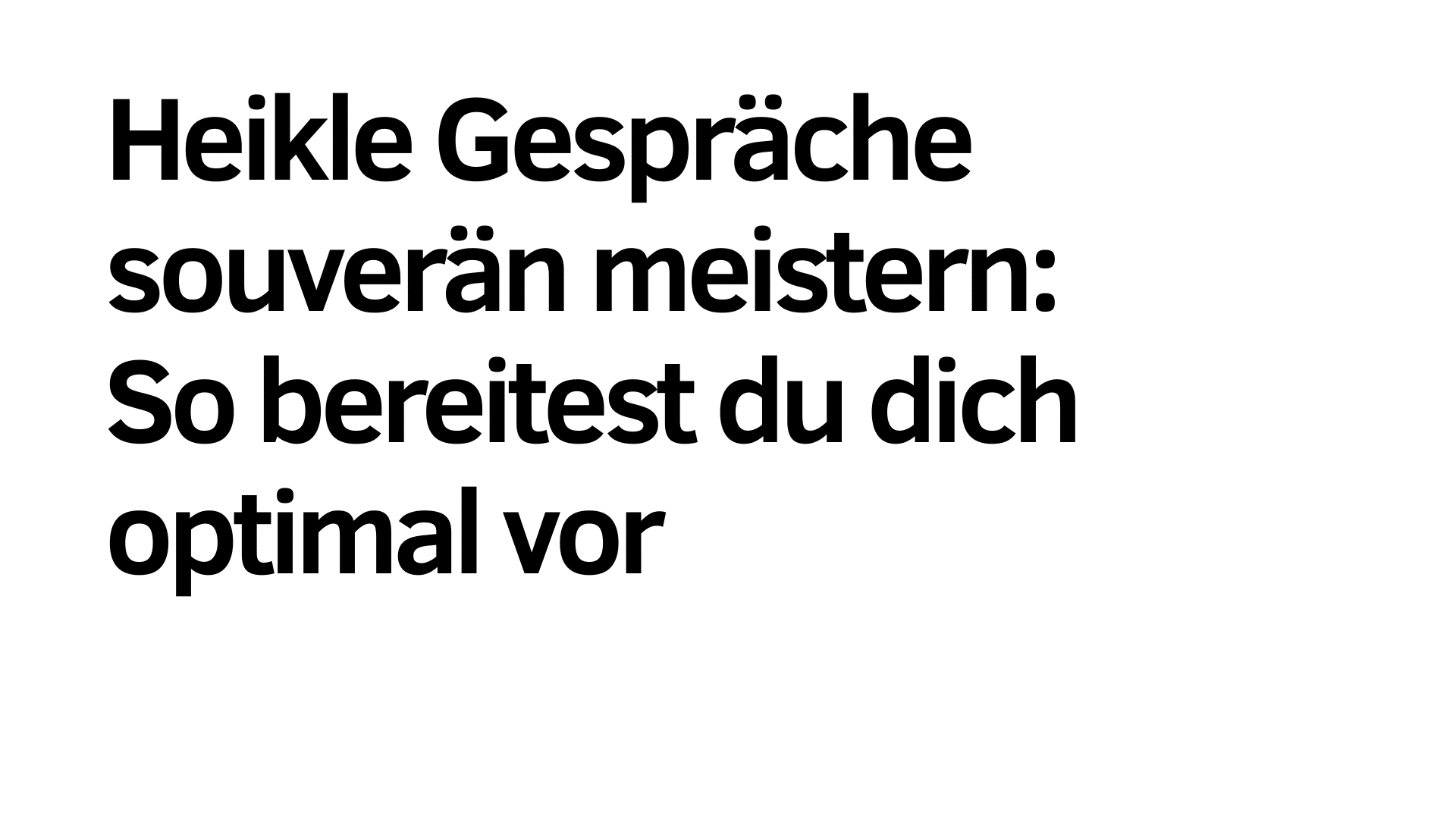
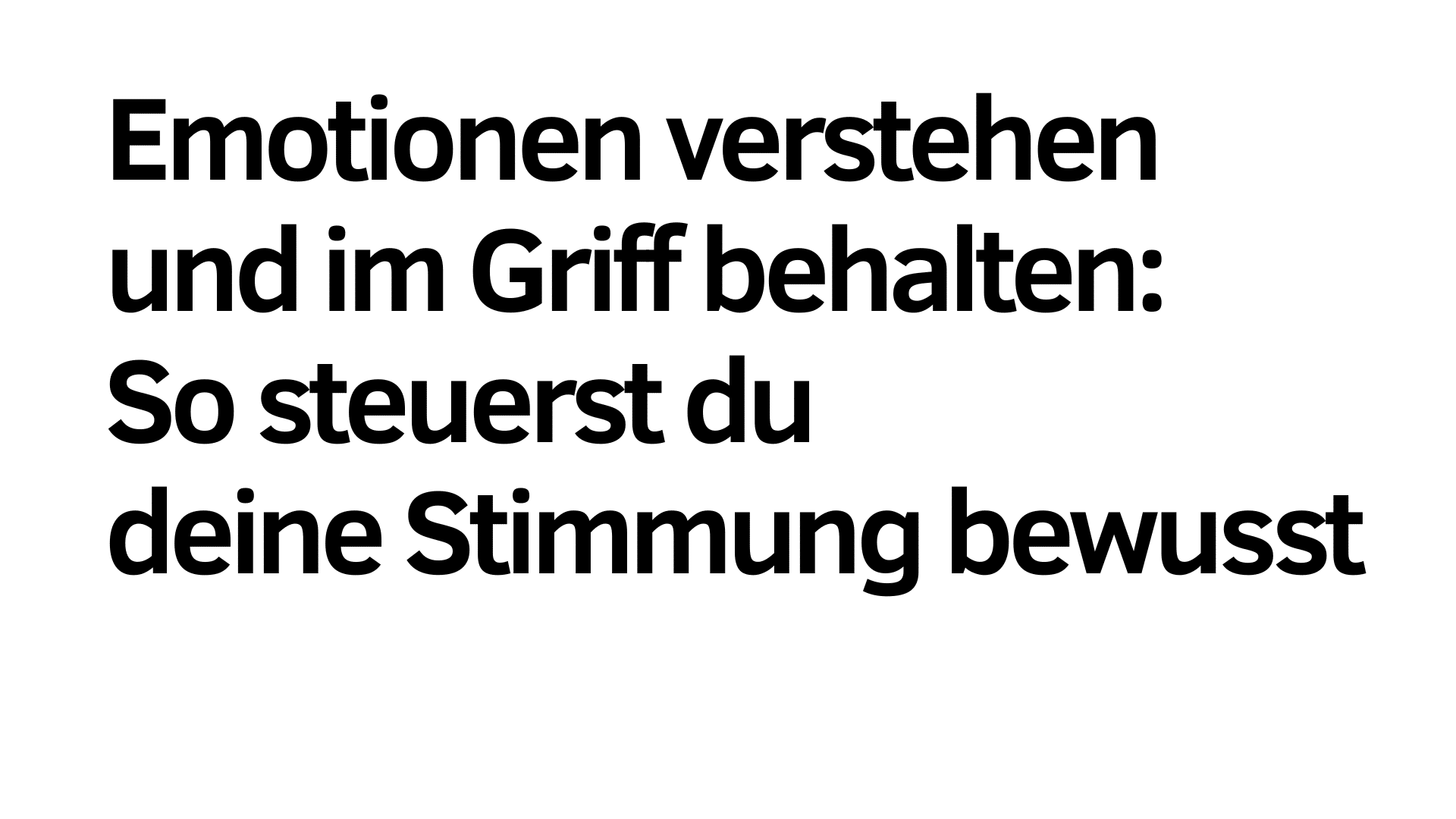
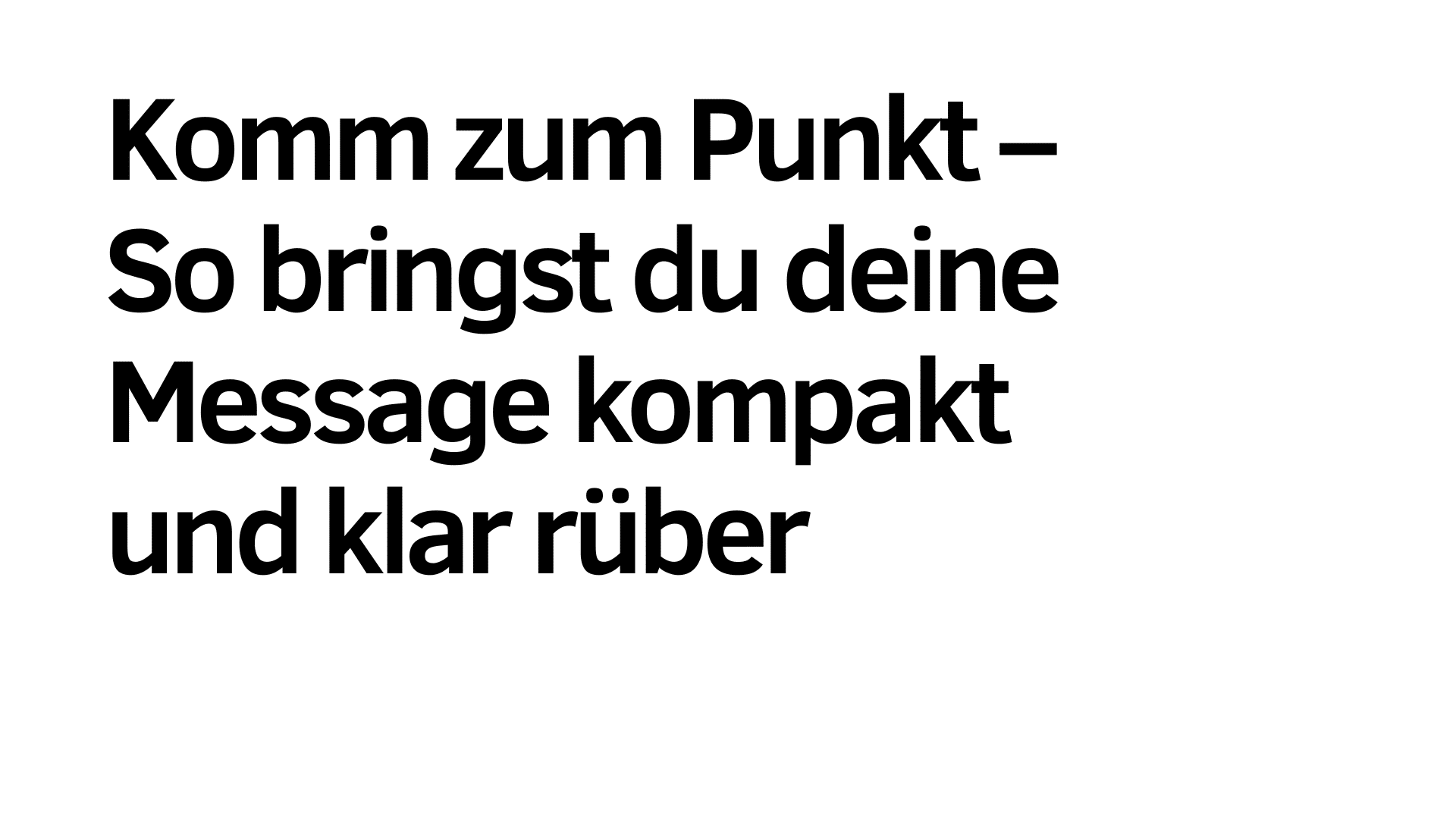
Hinterlasse einen Kommentar